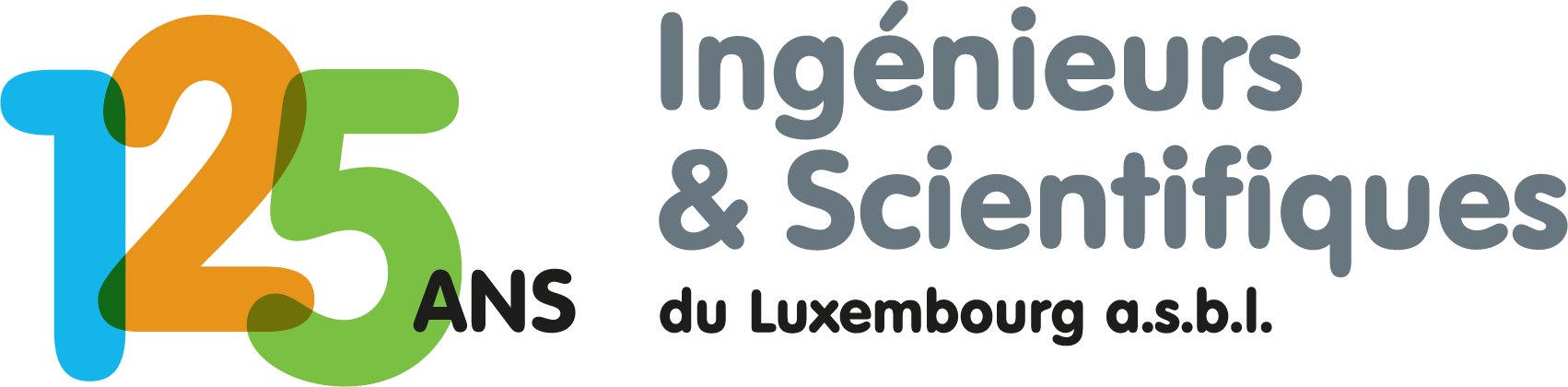ARCHITECT@WORK (24-25 avril 2024) est dans les starting-blocks
Les mercredi 24 et jeudi 25 avril 2024, vous avez rendez-vous dans les halls de Luxexpo The Box pour la cinquième édition d’ARCHITECT@WORK Luxembourg.
6, bd. G.D. Charlotte
L–1330 Luxembourg
T. : +352 45 13 54
F. : +352 45 09 32
ingsci@ingsci.lu