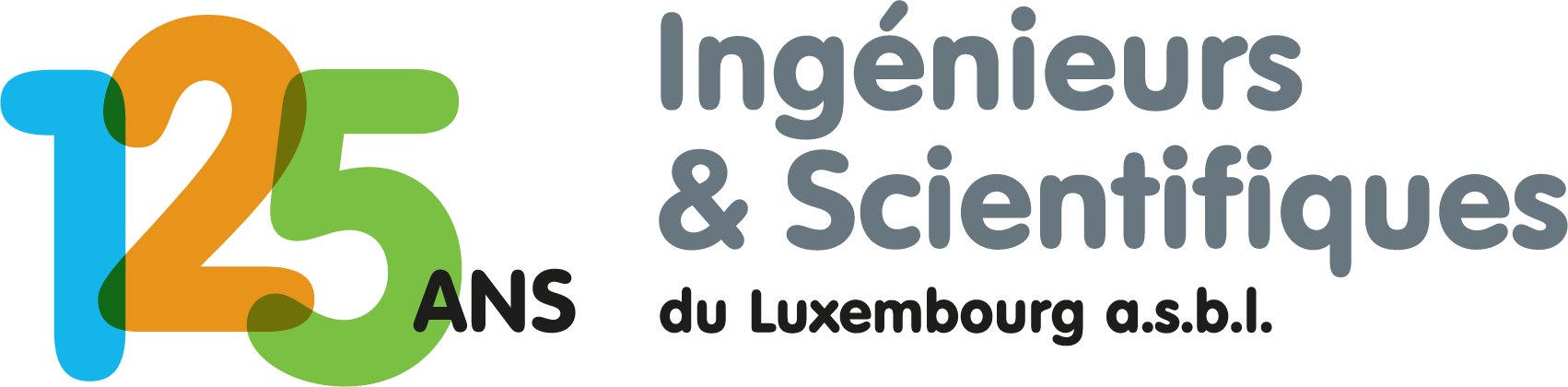Le panneau Solarcells: plus local, plus durable
Le circuit court, même pour les panneaux solaires, c’est le pari de Solarcells, qui a lancé une production au cœur de Luxembourg, dans les anciens bâtiments du cigarettier Heintz van Landewyck.
6, bd. G.D. Charlotte
L–1330 Luxembourg
T. : +352 45 13 54
F. : +352 45 09 32
ingsci@ingsci.lu